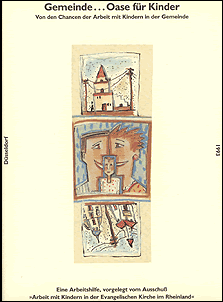1994 hat meine Landeskirche die Arbeitshilfe „Gemeinde … Oase für Kinder“ vorgestellt. Die folgende Arbeit ist eine religionspädagogische Analyse und kritische Würdigung.
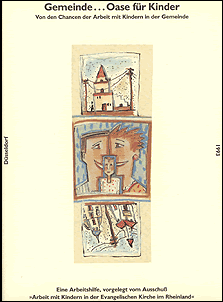
„Gemeinde … Oase für Kinder“
Von den Chancen der Arbeit mit Kindern in der Kirche.
Eine Arbeitshilfe, vorgelegt vom Ausschuß „Arbeit mit Kindern“ der Ev. Kirche im Rheinland, Düsseldorf 1993/1994
– Religionspädagogische Analyse und kritische Würdigung –
von Bernd Kehren
Inhalt
1. Einleitung
2.1 Kinder
2.2 Gemeinde
2.3 Kinder in der Gemeinde
2.4 Das Kind in der Familie
2.5 Kinder – von Gott angenommen
2.6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
3. Themen, die nicht vorkommen
4. Schluss
Literaturverzeichnis
Anhang 1: Peter Beier, Ein Testament?
Anhang 2: Inhaltsverzeichnis von „Gemeinde … Oase für Kinder“
Bestellmöglichkeit
„Kinderlärm ist Zukunftsmusik.“1
„Mir war klar, dass nicht das gesamte Presbyterium diese Auffassung mit mir teilen würde.“2
1. Einleitung
Schön, dass es diese Arbeitshilfe gibt. Wer sie mit einem offenen Herzen durcharbeitet, wird viele Anregungen bekommen. Man wird über den einen oder anderen Mangel in der Praxis der eigenen Gemeinde stolpern – hoffentlich wirklich nur den einen oder anderen. Und man wird entdecken, dass der Titel der Arbeitshilfe eigentlich ergänzt werden müsste:
„Gemeinde … Oase für Kinder – Kinder … Oase für die Gemeinde“.
2.1 Kinder
Traditionell3 gliedert sich die Betrachtungsweise von Kindern in folgende Bereiche: Kinder in der Familie (von der Geburt an). Hier findet das Kind die nötige Geborgenheit, um eine eigene Persönlichkeit zu werden, indem es nachahmen und sich identifizieren, sich aber auch reiben kann. Die erste religiöse Erziehung sollte in der Familie stattfinden. Das Versprechen der Gemeinde, sich an der religiösen Erziehung der Kinder zu beteiligen, wird ab ca. 3 Jahren im evangelischen Kindergarten und später im Kindergottesdienst wahrgenommen. Ungefähr mit der Konfirmation beginnt die Entwicklungsphase der Jugend. Dies entspricht in etwa übereinstimmender Auffassung, derzufolge mit etwa dem elften bis zwölften Lebensjahr der Übergang zum Jugendalter erfolgt. 4 Als Kinder hat die Arbeitshilfe etwa diese Altersgruppe bis etwa 12 Jahre im Blick.
2.2 Gemeinde
Blickt man auf die verschiedenen „Urgemeinden“ des Neuen Testaments, so bietet sich ein sehr vielfältiges Bild.5 Sie haben aber alle gemeinsam, dass sie auf bewusste Hierarchien verzichten und nur Christus als das Haupt anerkennen. Um die Einheit der Gemeinden in der Auseinandersetzung mit Häresien und wegen der immer länger ausbleibenden Parusie zu sichern, bildete sich das Amt des Bischofs und über die Dauer der Kirchengeschichte eine ausgeprägte Hierarchie. Es gab immer wieder Versuche, dies zu unterbrechen. Die Reformation führte zwar das allgemeine Priestertum der Gläubigen ein, konnte aber letztlich an der Amtsstruktur mit der Vorordnung des Pfarrers vor die Gemeinde nichts ändern. Im Pietismus entstand ein weiterer Versuch, die Hierarchien aufzuweichen, der sich aber ebenfalls nicht bis in die heutigen Landeskirchen durchsetzen konnte, sondern sich in freien selbständigen Werken eher neben den Kirchen verwirklichte. Gemeindepädagogik versucht, durch vielfältige Kommunikationsstrukturen und die ausdrückliche Beteiligung von Mitarbeitern zu neuen Umgangsweisen in der Gemeinde zu gelangen.
Dies spiegelt sich in der Arbeitshilfe vielfältig wieder, indem Kinder und ihre Eltern von Anfang an in ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten wahrgenommen werden und in einem großen Netzwerk der Gemeinde verbunden werden – in diesem Falle im Bild einer Oase.
2.3 Kinder in der Gemeinde
Betrachtet man die Arbeitshilfe hinsichtlich der beiden vorgenannten Punkte, so fällt auf, dass sie Kinder und Eltern nicht in der relativ starren Einteilung von Kindergarten und Kindergottesdienst begrenzt, sondern in ihren vielfältigen Bedürfnissen wahrnimmt. Als Ideal entsteht das Bild einer kinderorientierten Gemeinde, in der die Eltern nach der Taufe ihrer Kinder zu Gesprächskreisen (mit Babysitter-Vermittlung) und Eltern-Kind-Gruppen eingeladen werden. Sie sollen sich in ihrer speziellen Situation austauschen und dabei Gemeinde erfahren können. Ihre Teilnahme am Gottesdienst wird durch das Angebot von „Krabbelgottesdiensten“ ermöglicht, in denen die Eltern nicht verkrampft darum bemüht sein müssen, störenden Lärm ihrer Kinder zu vermeiden, die nichts anderes tun als ihrem entwicklungsgemäßen Erkundungs- und Bewegungsdrang nachzugeben. Vorbereitet werden diese als kleine Feste gestalteten Gottesdienste wiederum in den Eltern-Kind-Gruppen, in denen Eltern und Kinder neue Lieder geübt und Gegenstände selbst angefertigt haben. So vorbereitet werden die Familien auch beim Abendmahl nicht auseinander gerissen. Am gemeinsamen Leben mit den Kindern hat die Gemeinde gelernt, Glauben nicht nur vom Kopf her zu denken, und Abendmahl als ein Geschehen zu betrachten, das erlebt werden muss und das kein Diskussionsgegenstand für eine „intellektuelle Elite“6 ist.
Auf die Bedürfnisse von älteren Kindern, die vor allem in den Großstädten kaum noch Räume zur Selbstentfaltung haben, gehen Kindertreffs ein. Durch regelmäßige Besuche und gemeinsam gestaltete Gottesdienste und Feste entstehen über Eltern, Großeltern, Bekannte und Nachbarn, aber auch über übergemeindliche Verknüpfungen etwa zur Grundschule und zum Jugendamt weitere Kontakte: Kinderorientiere Gemeinde als Form des Gemeindeaufbaus. Behinderte Kinder werden bewusst in integrative Kindergärten aufgenommen und es werden Freizeiten mit ihnen gemeinsam durchgeführt.
2.4 Das Kind in der Familie
Familie ist sehr privat und darin sehr autonom geworden und entsteht, „indem Eltern und Kinder ihre Gemeinschaft selbständig gestalten.“7 Familie kann für das Kind Heimat werden, indem es sich mit seinen Bezugspersonen identifiziert und dabei aktiv eigene Handlungs- und Deutungsmöglichkeiten findet. Die Privatheit der Familie bietet Chancen und Gefährdungen. Weil Familien so klein geworden sind, fehlen den Mitgliedern unter Umständen Rückzugsmöglichkeiten, etwa zu anderen Verwandten. Die Konsumwelt ersetzt Symbole alter Lebensformen und transportiert vorgefertigte Lebensmuster bis ins Kinderzimmer. Die Enge in der Familie macht diese „Nische des Glücks“8 zerbrechlich. Um innerlich wachsen zu können braucht das Kind Bestätigung und Möglichkeit zur Abgrenzung. Es ist erforderlich, dass die Eltern sich selbst und den Kindern gegenüber als verschieden, unabhängig und gleichrangig behandeln. Kinder brauchen die Erfahrung, unbedingt bejaht zu werden.
Gemeinde wird nur dann Oase für Kinder, wenn sie auch die Familien und deren Situation im Blick hat. Konkret wird dies an verschiedenen Teilen der Arbeitshilfe. Es fängt sofort mit dem Thema „Abendmahl mit Kindern“ an, setzt sich mehrfach unter dem Thema „Vernetzung der Gemeinde über ihre Kinderarbeit“ fort. „Beratung – Sexueller Mißbrauch an Kindern“ ist ein weiterer Punkt. Ganz praktisch ist die „Standortbestimmung“ von Adolf-Leopold Krebs, die mit einer Vision endet, in der die zugezogene Familie auf die Angebote der Gemeinde aufmerksam gemacht wird – einschließlich der Babysitter-Vermittlung für die Veranstaltungen für junge Eltern. Manchmal sind es gerade die liebevollen „Kleinigkeiten“, die Gemeinde zur Oase werden lassen. Im dritten Teil der Arbeitshilfe kommt die Familie in den Kapiteln über Gottesdienste mit Kleinkindern, und über Eltern-Kind-Gruppen in den Blick. Für beides gilt: Sie ermöglichen den Kindern, ihre Bedürfnisse nach Bewegung, räumlichen Erkundungen, neuen Beziehungen, Äußern ihrer Lebensfreude zu erfüllen. Den Eltern wird gezeigt, dass sie in ihrer Lebenssituation akzeptiert werden, ihnen werden Kontakte zu anderen ermöglicht, sie lernen, einfach, verständlich und kindgerecht ihren Glauben nahezubringen und sie erhalten eigene religiöse Orientierung.9
2.5 Kinder – von Gott angenommen
Drei neutestamentliche Charakteristika für die Begegnung Jesu mit Kindern zählt die Arbeitshilfe auf:10
- „Kindern wird Das Reich Gottes eben nicht wegen besonderer subjektiver Fähigkeiten zugesprochen, sondern gerade weil ihnen … objektiv die besonderen Fähigkeiten fehlen.“11
- Theologisch drückt sich darin die Erkenntnis des sola gratia und sola fide aus.
- Das Kind hat bei Jesus einen Ehrenplatz (Lk 9,47).
„Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht.“ (Mk 10,14) Indem Jesus die Kinder hautnah zu sich nimmt, betont er die Bedeutung dieses Wortes und stellt sie so „direkt neben die Mühseligen und Beladenen, die Armen, die Sünder, die Verlorenen, die Leidenden“ der Seligpreisungen.
Dies sollte auch in der Theologie zum Ausdruck kommen. „Das Kind ist also nicht Objekt der Belehrung, unfertiges Rohmaterial, das irgendwann zum Erwachsenen und vollwertigen Gemeindeglied heranreifen wird. Das Kind hat schon jetzt den Ehrenplatz.“12
Deswegen empfiehlt die Arbeitshilfe auch gegen vielfältige Einwände u.a., die Arbeit mit Kindern zum Mittelpunkt einer Vernetzung in der Gemeinde zu machen.13 Die Gemeinschaft Gottes mit den Kindern wird z.B. auch im Beitrag über „Kindergarten, Kindertagesstätte, Hort“ hervorgehoben – zusammen mit den Möglichkeiten zur Vernetzung in der Gemeinde, aber auch außerhalb von ihr. 14
Der vollen Annahme der Kinder durch Gott entspricht die Erkenntnis, dass auch Kinder auf ihre Weise vollwertige Menschen sind. Dementsprechend kann sich die Gemeinde nicht in zwei Gruppen teilen, so dass die eine Gruppe „diakonisch“ für die andere sorgt und diese die Hilfe ohne echte Möglichkeit zu einer Gegenleistung entgegennehmen muss. Die Arbeitshilfe stellt gegen eine solche kirchlich-theologische Apartheitsstruktur 15 ausdrücklich „Ulrich Bachs Plädoyer für eine solidarische Diakonie, die nicht im „Machen für“, sondern im „Leben mit“ besteht, in der Bejahung eines Menschenbildes, das das Angewiesensein und die Bodenlosigkeit einschließt“. 16 Zum Umgang mit der Bibel wird in diesem Zusammenhang gesagt: „Die entsprechenden Texte sind nicht nur auszulegen, (sondern) zu begehen und zu feiern.“17
Dies äußert sich in der Arbeitshilfe auf mehrfache Weise.
a) Damit Kinder volles Gehör finden, wird empfohlen, etwa einen Kinderpresbyter oder eine Kinderpresbyterin zu bestimmen. 18 In einem gewissen Gegensatz dazu steht – mir nicht ganz verständlich – die Bemerkung von Rüdiger Maschwitz, „kinderorientierte Gemeinde“ meine nicht, „daß die Kinder die Gemeindearbeit bestimmen und sagen, wo es lang geht.“ 19 Wenn Gemeinde wirklich ein Geben und nehmen ist und Kinder ernstgenommen werden sollen, dann müssen sie auch mitbestimmen können, „wo es lang geht“. Es entspricht den feinen und vorsichtig kritischen Bemerkungen dieser Arbeitshilfe, wenn ich behaupte, dass es vielerorts ganz im Gegenteil so ist, dass Kinder überhaupt nicht wahrgenommen werden – da, wo es lang geht. So empfiehlt im Schlusswort Präses Peter Beier „seinem Enkel“: „Vergiß uns, mein Junge, wenn es sein muß… Misch‘ dich ein. Halte dich nicht heraus… Besser ist es, zu widerstehen.“20 Auch wenn dies bei Kindern seine Grenzen hat: Die „Großen“ sind aufgerufen, auf Kinder in der Gemeinde zu achten, „aber nicht nur als ein Gegenstand in Gruppen, sondern als Menschen, die wir von Angesicht zu Angesicht kennen und schätzen.“ 21
b) Dieses Menschenbild äußert sich weiterhin darin, wie auf verschiedenste Weise behinderte und benachteiligte Kinder in den Blick kommen. „Von behinderten Kindern Gemeinde leben lernen. Das kleine Glück … und noch viel mehr“ 22 und „Beratung – Sexueller Mißbrauch an Kindern“ 23 sind Titel im ersten Teil der Arbeitshilfe,. und im dritten Teil widmen sich gleich drei weitere Beiträge um behinderte Kinder: Integrative Kindergärten werden vorgestellt 24 und eine Stellungnahme der rheinischen Landeskirche dazu abgedruckt25, sowie ein Beitrag über „integrative Freizeiten“ 26.
c) Die Kinder kommen nicht nur „in den Blick“, sind nicht nur Empfänger von Gaben; im Kontakt mit ihnen kann man auch eine Menge lernen, was man ohne sie vergessen würde. Werner Pohl beschreibt, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinderarbeit wachsen und über sich selber lernen. 27 Und er erzählt, wie Pfarrerinnen und Pfarrer eine neue lebendige Beziehung zur Theologie bekommen. „Es fällt ihnen leichter, Glauben beim Namen zu nennen, „Gott“ zu sagen, sich ihres eigenen Glaubens zu freuen. Sie lernen, die biblische Botschaft elementar zu verkündigen, das Evangelium so umzusprechen, daß es verstehbar, auch fühlbar und greifbar wird. Sie entdecken: So eine elementare Verkündigung brauchen nicht nur Kinder, sondern ebenso Erwachsene.“ 28 Ein anderes Beispiel erzählt Günter Ruddat von einem geistig behinderten Kind, das nach der eigenen Einsegnung mit den leise gestammelten Worten „Du auch!“ den Pfarrer segnet: „Nach dem Gottesdienst beginne ich langsam zu verstehen: Birgit hat mich aus der „amtlichen“ Funktion heraus-gelöst und ihren Segen weitergegeben. Wer hat das schon gelernt?“29Das führte dann dazu, dass in einem Kindergottesdienst später diese Erfahrung modifiziert weitergegeben wurde, als „Segen“ erklärt werden sollte. Damit wird Behinderung nicht verklärt und es wird ihr auch kein besonderer Sinn gegeben. (Als ob Nichtbehinderung verklärt würde, wenn man Nichtbehinderten oder Erwachsenen unterstellte, dass man von ihnen lernen könne!) Aber Behinderte und Kinder werden damit als eigenständige Menschen in einer echten Beziehung wahr- und ernstgenommen.
d) Nicht zuletzt gehört zum Kindsein das Spielen. Die Arbeitshilfe lenkt den Blick darauf, dass davon auch Erwachsene lernen können, insbesondere sich in andere Menschen hineinzudenken und Probleme zu lösen. Die Spiele, mit denen das Heft eingeleitet wird und mit denen es ausklingt, sind ein gutes Beispiel dafür. Direkt zum Einstieg 30 werden vier Gruppen zusammengebeten („Pfarrer/in und Hauptamtliche“, „Presbyterinnen und Presbyter“, „Eltern und andere Gemeindeglieder“ sowie „Kinder“), um Menschen aus dem Presbyterium, aus dem Pfarramt, aus der ganzen Gemeinde oder aus einer Jugendfreizeit die Möglichkeit zu geben, sich in das Denken und Fühlen anderer zu versetzen. Jede Gruppe erhält eine Rollenbeschreibung und eine Situation vorgegeben, in der letztlich die Frage diskutiert wird: „Wo/wie müssen wir ansetzen, was wäre zu tun (oder zu lassen), um von der Kirchengemeinde her Kinder anzusprechen und zu gewinnen.“ Anschließend treffen sich alle Gruppen zur „Gemeindeversammlung“, um in einer zweiten Runde des Spiels die Fragen zu vertiefen.
Ein umfangreiches Brettspiel zum Ausschneiden und Aufkleben mit Ereignis- und Fragekarten rund um die Räume eines Gemeindezentrums und den Gemeindesaal bildet den Schluss und lädt ein, sich beim Spielen Gedanken über die Kinderarbeit in der Gemeinde zu machen. Die Grenzen zwischen Spiel und Arbeit (Nachdenken über Gemeindekonzeption und welche Rolle die Arbeit mit Kindern darin spielt) verschwimmen. Und so wird insgesamt deutlich, dass Gemeinde nicht nur aus bitterem Glaubensernst besteht, sondern es scheint auch etwas von der spielerischen Leichtigkeit des Himmels hindurch, in den man nur gelangen kann, wenn man wird wie die Kinder – während gleichzeitig sehr ernst und konzentriert über die konkreten Verhältnisse nachgedacht wird.
2.6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wie schon unter 2.2 kurz ausgeführt, ist unsere Kirche bis heute davon geprägt, dass Pfarrer allein durch ihre Dienstvorschrift jeweils die letzte Entscheidungsbefugnis haben. Modelle der Gemeindepädagogik versuchen, ein partnerschaftlicheres Verhältnis einzuführen. Damit die oben genannten Vernetzungsstrukturen funktionieren können, braucht es qualifizierte, eigenverantwortliche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei werden drei Grundqualifikationen unterschieden 31: Eine theologisch-hermeneutische, eine theologisch-pädagogische und eine theologisch-sozialdiakonische Qualifikation. Eine Ausbildung in allen drei Bereichen bedeutet aber eine Überforderung. „Universalkompetenz führt zu Universaldilletantismus.“32 Die Arbeitshilfe deutet das Problem schon an einer Überschrift an: „Ein bißchen mit Kindern arbeiten kann doch jede/r, oder?“33 So werden qualifizierte Mitarbeiter demotiviert und die in 2.4 angedeuteten Probleme verniedlicht und verharmlost. Häufig werden Jugend- und Kinderarbeit gegeneinander ausgespielt, genau wie auch ehrenamtliche gegen hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das soll nicht sein. Angesichts der sehr unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungen z.B. von Eltern, die eine sorgfältige Garantie der Aufsichtspflicht verlangen und denen der Kinder, die nicht nur spannende Programme geboten bekommen wollen, sondern auch Anerkennung und ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Solidarität, brauchen ehrenamtliche Mitarbeiter eine optimale Ausstattung der Arbeit und eine angemessene Beratung und Begleitung seitens der Hauptamtlichen.34 Diese stehen wiederum in einem ständigen Rollenkonflikt mit den Leitungsgremien, dass sie die Zielsetzung der Gemeinde unterstützen, ständig zur Verfügung stehen, Teamfähigkeit beweisen, sorgsam mit dem Geld umgehen und für saubere Räume sorgen. 35 „Zur Erreichung dieser Ansprüche benötigen hauptberuflich Tätige Planungssicherheiten und Anerkennung der Professionalität ihrer Arbeit. Es ist mehr denn je notwendig, dass Leitungsgremien in Gemeinden wegkommen von der bisherigen Denkweise, dass ihre Angestellten „Mit“-ArbeiterInnen sind, die u.a. in der Arbeit mit Kindern mitarbeiten. Hauptberuflich Tätige verantworten ihre Arbeitsbereiche weitestgehend selbständig und brauchen die Anerkennung ihrer Tätigkeit als Arbeit.“ 36 Dabei gilt aber, dass die Arbeit nur von hauptamtlichen Kräften nicht zu bewältigen ist. Insbesondere die Kindergottesdienstarbeit belegt dies mit ihrer großen Zahl freiwilliger Helferinnen und Helfer.
3. Themen, die nicht vorkommen
a) Vermisst habe ich einen Beitrag über die Taufe. So manche Taufe habe ich schon erlebt, die eher lieblos (und gar nicht wie eine „Oase“) irgendwie im Haupt- oder Kindergottesdienst untergebracht war und mehr oder weniger zügig nach Agende „durchgezogen“ wurde. Die vielen Säuglinge dürften dies zwar nicht merken. Dafür empfinden die leider häufig nicht sehr mit Gottesdienst vertrauten Eltern und Paten sehr deutlich, wie einladend der Gottesdienst auch für sie gestaltet war – oder nicht. Noch vor der Krabbelgruppe ist der Taufgottesdienst häufig nach langer Pause der erste Kontakt zur Gemeinde. Und ein solcher erster Eindruck kann die ganze weitere Beziehung prägen, in die das Kind – vermittelt zunächst durch seine Eltern – zur „Gemeinde-Oase“ eintritt oder nicht.
Gemeindepädagogische Möglichkeiten zur Gestaltung der Taufe 37 bestehen darin, schon im Taufgespräch erahnen zu lassen, wie Erwachsene und Kinder Gemeinschaft haben, indem sie Ängste beim Namen nennen und Hoffnungen und Befürchtungen aussprechen können. Sie sollen sich eingebunden fühlen können zwischen Paten und Gemeinde. Biblisch verankerte Symbole wie Wasser, Licht, Baum und Erde können besprochen und dann im Gottesdienst überreicht werden, vielleicht wird sogar ein kleiner Baum auf dem Gemeindegrundstück gepflanzt. Die Gemeinde kann die Gemeinschaft ausdrücken, indem sie die Taufeltern mit einem Kreis um den Taufstein umschließt und Wünsche für das Kind und seine Familie äußert. Vielleicht erhalten die Eltern ein Erinnerungsblatt, das nach dem Gottesdienst von der ganzen Gemeinde, evtl. bei einer Tasse Kaffee unterschrieben wird. Auf diese Weise könnte die Annahme durch Gott durch die Annahme durch Menschen ausgedrückt werden – wenn Gemeinde Oase für Kinder ist, bleibt dies auch nicht auf den Taufgottesdienst beschränkt.
b) Angeregt durch ein Buch von Josef Quadflieg habe ich weiterhin einen Beitrag über Kinder und Theologie 38 vermisst. Er würde wohl am besten in den mittleren, theoretischen Teil passen. Was löst Kirche bei Kindern (also noch keinen Jugendlichen) aus, wenn über Sünde oder den Teufel gesprochen wird? Nicht gerade selten geistern in den Köpfen der Erwachsenen noch Gedanken herum über Gott, der alles sieht und der Sünde bestraft – lange bevor Kinder überhaupt begreifen können, was damit gemeint ist. Aber diese Gedanken sind ausgesprochen und können in Kindern ein verheerendes Eigenleben annehmen. In weniger dramatischen Fällen kann es dazu beitragen, die Kinder langfristig von der Kirche und von Gott zu entfremden. So kann Gemeinde äußerlich zwar einer einladenden Oase gleichen, aber das Wasser in ihr wird als vergiftet empfunden.
Einige Beispiele sollen das verdeutlichen. 1967 wurden im römisch-katholischen „Rahmenplan für die Glaubensunterweisung“ der deutschen Bischöfe die Schöpfungserzählungen der Genesis aus den Grundschulbüchern vertrieben und erst für das 8. Schuljahr, also für 13 bis 14jährige Jugendliche vorgesehen. Die Jugendlichen sollen erst mit der Schöpfungsgeschichte bekanntgemacht werden, nachdem sie mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild konfrontiert wurden, damit biblische und naturwissenschaftliche Aussagen nicht zu Konkurrenzaussagen werden. 39 Das heißt nun nicht, dass „Schöpfung“ im Kindesalter nicht vorkommen darf. Nach einem Spaziergang im Wald etwa kann man die Kinder das Erlebte mal lassen. „Im Gespräch werden Sie sagen: Es gibt Menschen, die glauben: Das alles kommt von Gott. Sie sagen: Gott erschafft alles. Sie sagen: Gott, dafür loben wir dich! Dafür danken wir dir! – Es gibt andere Menschen, die sagen: Gott? Gott, das gibt es nicht. – Wenn Sie wollen, fügen Sie hinzu: Ich zum Beispiel, ich glaube, daß alles von Gott kommt.“ 40 Wichtig ist dabei auch die Aussage im Präsens, um den Eindruck zu vermeiden, dass „Schöpfung“ etwas schon abgeschlossenes ist.
Genauso empfiehlt Quadflieg etwa, nicht von Engeln zu Kindern zu sprechen. und entsprechende Bibelstellen ruhig auch auszulassen: „Die Kinder machen sich sonst märchenartige Vorstellungen, die dazu angetan sind, daß sie später sagen: Die ganze Bibel ist ein Kindermärchen; damit wollen wir als Jugendliche nichts mehr zu tun haben. Jeder Religionslehrer einer Hauptschule oder eines Gymnasiums kann Ihnen das bestätigen.“ 41
Ich halte es für wichtig, über diese Problematik aufzuklären und auch Eltern Hilfestellung für die religiöse Erziehung ihrer Kinder zu geben, auch wenn die Problematik z.B. bei der Zusammenstellung der Kindergottesdiensttexte sicherlich berücksichtigt wird. Dabei muss von der Sache her nichts Wichtiges ausgelassen werden, auch wenn bestimmte Begriffe und Inhalte zunächst ausgeklammert bleiben.
4. Schluss
Es bleibt nun nur noch zu wünschen, dass diese Arbeitshilfe – vielleicht in der angegebenen Weise erweitert – möglichst weite Verbreitung findet und mithilft, dass möglichst viele Presbyterien keine Widerstände mehr entgegenbringen, wenn sich Menschen dafür engagieren wollen, dass es im Gemeindehaus etwas lauter wird. Im Gegenteil: Wenn es zu leise wird, muss dies zum Nachdenken führen, wo wohl die Kinder geblieben sind.
Fußnoten
1. Unbekannt.
2. Veronika Kohmüller, 115.
Seitenangaben ohne Titelangabe beziehen sich immer auf die dieser Arbeit zugrunde liegende Schrift.
3. vgl.: Adam/Lachmann: Gemeindepädagogisches Kompendium.
4. Rainer Lachmann, TRE „Kind“, 156.
5. vgl. im Folgenden: Karl Foitzik: Die Mitarbeiter in den gemeindepädagogischen Handlungsfeldern. in: Adam/Lachmann, a.a.O., 162ff.
6. Gerda Schmeer, 18.
7. Harald Bewersdorf, 56.
8. Harald Bewersdorf, 57.
9. vgl. Doris Sandbrink, 113f – Gert René Loerken, 98f.
10. Harald Bewersdorff, 55f.
11. B. Vrijdaghs, Werden wie Kinder, EvErz 1980, S. 173f. Zitiert nach Harald Bewersdorf, 55.
12. Harald Bewersdorff, 56.
13. Rüdiger Maschwitz, 39f.
14. Adolf-Leopold Krebs und Rdiger Maschwitz, 24f.
15. vgl. Ulrich Bach: „Gesunde“ und „Behinderte“ : Gegen das Apartheidsdenken in Kirche und Gesellschaft. Göttingen, 1994.
16. Henning Schröer, 72. Vgl. Ulrich Bach: Boden unter den Füßen hat keiner : Plädoyer für eine solidarische Diakonie. Göttingen, 1980.
17. Henning Schröer, 72.
18. Erika Georg-Monney, 50.
19. Rüdiger Maschwitz, 39.
20. Peter Beier, Ein Testament? Aus dem Bericht des Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland auf der Landessynode 1993 (Schlussteil), 127.
21. Rüdiger Maschwitz, 39.
22. Günter Ruddat, 28-30.
23. Friederike Stratmann, 44f.
24. Elsegret Pflug, Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in evangelischen Kindergärten, 70f.
25. Entwurf einer Stellungnahme der rheinischen Kirchenleitung. Intergration beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher, 80-84.
26. Jürgen Danielowski, 86f.
27. Werner Pohl, 22f.
28. Werner Pohl, 23.
29. Günter Ruddat, 29.
30. Jürgen Koerver, 11f.
31. Foitzik in: Adam/Lachmann, 176.
32. Foitzik in: Adam/Lachmann, 176.
33. Erika Georg-Monney, 34.
34. Erika Georg-Monney, 35.
35. Erika Georg-Monney, 36.
36. Erika Georg-Monney, 36.
37. Failing: Religiöse Erziehung in der Familie. In: Adam/Lachmann, 213f.
38. Josef Quadflieg: Theologie in Kinderköpfen? 10. Auflage Donauwörth, 1987.
39. Josef Quadflieg: Theologie in Kinderköpfen?, 79ff.
40. Josef Quadflieg: Theologie in Kinderköpfen?, 81.
41. Josef Quadflieg: Theologie in Kinderköpfen?, 37.
Literaturverzeichnis
„Gemeinde … Oase für Kinder“ : Von den Chancen der Arbeit mit Kindern in der Kirche. Eine Arbeitshilfe, vorgelegt vom Ausschuß Arbeit mit Kindern der Ev. Kirche im Rheinland. Düsseldorf, 1993/1994
(Seitenangaben ohne Titelangabe beziehen sich immer auf die dieser Arbeit zugrunde liegende Schrift.)
Gottfried Adam / Rainer Lachmann (Hg.): Gemeindepädagogisches Kompendium. Göttingen 1987.
Rainer Lachmann: TRE: Artikel „Kind“ .
Ulrich Bach: „Gesunde“ und „Behinderte“ : Gegen das Apartheidsdenken in Kirche und Gesellschaft. Göttingen, 1994.
Ulrich Bach: Boden unter den Füßen hat keiner : Plädoyer für eine solidarische Diakonie. Göttingen, 1980.
Josef Quadflieg: Theologie in Kinderköpfen? 10. Auflage. Donauwörth, 1987.
Anhang 1
Peter Beier
Ein Testament?
Aus dem Bericht des Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland auf der Landessynode 1993
(Schlußteil)
Vielleicht ist nun alles, was wir. . . erörtern und bedenken, bedeutungslos im Angesicht der umfassenden Bedrohung, in die wir unseren Planeten manövriert haben und weiter manövrieren.
Die Wälder sterben.
Diese Rasse wird nichts lernen, selbst dann nicht, wenn ihr die Sonne Krebsflecken auf die Haut brennt.
Die einzige Hoffnung, die bleibt, findet für mich in einem schlichten frommen Satz der Väter und Mütter im Glauben Ausdruck: Gott, der Herr, sitzt im Regiment.
Es wird regiert.
Das sind keine Selbstberuhigungen, sondern Aufforderungen zu zähem Kampf für den Bestand der Schöpfung und die Erhaltung der Art, wenn es Gott gefällt.
Hätte ich jetzt ein Testament zu hinterlassen, ich schriebe meinem Enkel so:
Komm, ich erzähl‘ dir die Geschichte vom Turmbau zu Babel.
Die Geschichte erzählt dir alles über mich und meine Generation.
Sie erzählt alles über den Menschen.
Du fragst, was wir mit eurer Zukunft gemacht haben.
Du fragst, was ich gegen explodierenden Wahnsinn unternahm.
Ich kann vor deinen Fragen nicht bestehen.
Was wir gesagt und getan haben, war halbherzig genug.
Ich gehörte zu denen, die in Gottes Namen warnen wollten.
Das war viel zuwenig, wir hätten widerstehen müssen.
Aber es mangelte uns an Phantasie und Löwenmut.
Es mangelte an gemeinsamer Sprache.
Wir haben geredet. Aber aneinander vorbei.
Wir haben argumentiert. Aber über Köpfe und Herzen hinweg.
Das ist unsere Schuld.
Du trägst die Folgen. Nicht ich.
Wenn es für dich etwas zu lernen gibt, dann das:
Unsere Maßstäbe, unsere Werte taugen nicht zum Überleben.
Unsere Sprache ist verbraucht.
Unsere Denkgewohnheiten sind verelendet.
Darum sei genau, mein Junge.
Gib keinen Rabatt auf nachträgliches Gejammer.
Die Menge der Leute wird dir versichern:
Das haben wir nicht gewußt. Glaub‘ ihnen nicht.
Sie haben gewußt, was zu wissen war.
Sie hätten es wissen können.
Andere werden dir sagen:
Wir konnten nichts machen.
Glaub‘ ihnen nicht.
Sie hätten eine Menge machen können.
Vergiß uns, mein Junge, wenn es sein muß.
Es ist Zeit, uns zu vergessen.
Wie die Turmbaugeschichte lehrt.
Mach‘ dich mit anderen auf die Suche nach der neuen Sprache.
Sie ist da.
Buchstabiere das Wort Jesu Christi, besser als es uns je gelang.
Misch‘ dich ein. Halte dich nicht heraus.
Aus Politik und Wissenschaft.
Mach‘ dich sachkundig.
Nimm den Spaten und betrachte die Erde.
Lies die Seekarten.
Sprich mit den Fischen.
Sie werden dir antworten.
Mach‘ keine große Karriere.
Besser ist es, zu widerstehen.
Vielleicht ist das Ende offen.
Für dich und die Deinen.
Anhang 2:
Inhaltsverzeichnis von „Gemeinde … Oase für Kinder“
5
Vorwort des Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland
6
Gemeinde. . . Oase für Kinder
Vorwort von Wolfgang Engels und Rudiger Maschwitz
10
Mitglieder des Ausschusses »Arbeit mit Kindern in der Evangelischen Kirche im Rheinland«
11
Zum Einstieg: Kind in der Gemeinde. Ein Rollenspiel
von Jürgen Koerver
14 Oase für Kinder.
Einleitung zum 1. Teil
I
In der Oase – zwischen Wüste und Paradies
Wichtige Handlungsfelder kirchlicher Arbeit mit Kindern
17
Abendmahl mit Kindern. Erfahrungen in der Gemeinde
von Gerda Schmeer
20
Kindergottesdienst. Eine Vision
von Werner Pohl
24
Kindergarten, Kindertagesstätte, Hort. Plädoyer für ein elementares kirchliches Handlungsfeld
von Adolf-Leopold Krebs und Rüdiger Maschwitz
26
Zur klassischen Gruppenarbeit: »Jungschar ade?!«
Interviews zur Arbeit mit Kindern in zwei Landgemeinden im Kirchenkreis Krefeld
von Veronika Kohmüller
28
Von behinderten Kindern Gemeinde leben lernen. Das kleine Glück… und noch viel mehr
von Günter Ruddat
31
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine besondere Chance für alle
von Luise Pawlowsky
34
Zur Situation hauptberuflicher »Mit«-Arbeiterlnnen in der Arbeit mit Kindern
Ein bißchen mit Kindern arbeiten kann doch jede/r, oder?
von Erika Georg-Monney
31
Musizieren mit Kindern mit Herzen, Mund und Händen für den Leib Christi
von Ursula von den Busch und Michael Heering
39
Kinder in der Gemeinde. Die Vernetzung der Orte, an denen Kinder in der Gemeinde sind
von Rüdiger Maschwitz
41
Schule und Gemeinde. Zur Ganztagsbetreuung und Folgen für die Arbeit mit Kindern
Statements, gesammelt von Rüdiger Maschwitz und Markus Homann
44
Beratung – Sexueller Mißbrauch an Kindern. Gemeinde als Oase
von Friederike Stratmann
46
Sind wir eine kinderfreundliche Kirche?
Was zu tun ist, um das zu werden. Standortbestimmung und Perspektiven
von Adolf-Leopold Krebs
49
Prüfsteine für die Arbeit mit Kindern
von Erika Georg-Monney
52 Schwierige Wege zwischen Wüste und Oase.
Einleitung zum 2. Teil
II
Eine Oase hat viele Quellen
Grundsätzliches zu einer kirchlich-gemeindlichen Arbeit mit Kindern
55
Das Bild der Kinder in der Bibel – Das Bild des Kindes in der Familie
von Harald Bewersdorff
62
Grundlegende Informationen zum Leben der Kinder
und Anregungen zu einer kinderorientierten Gemeindearbeit
von Rüdiger Maschwitz
71
Möglichkeiten eines kinderfreundlichen Gemeindeaufbaus
von Henning Schwer
76
Die Oase bringt Früchte.
Einleitung zum 3. Teil
III
Früchtekorb
Beispielhafte Hoffnungszeichen und Perspektiven aus der Arbeit mit Kindern
Behinderte Kinder
78
Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in evangelischen Kindergärten
von Elsegret Pflug
80
Integration beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher
Entwurf einer Stellungnahme der rheinischen Kirchenleitung
86
Integrative Freizeiten
von Jürgen Danielowski
Kindergottesdienst
88
Die Tempelreinigung. Ein Rollenspiel zu Mt 21,12-17
von Werner Pohl und Lothar Wand
91
Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? (Lk 24,1-12)
Ein Ostergottesdienst, der auch als Familiengottesdienst gefeiert werden kann von Werner Pohl
95
Kinder-Bibel-Tage. Bericht über biblisch orientierte Kindertage
von Ernst Richter
98
Gottesdienste mit Kleinkindern
von Gert Rene Loerken
100
Krabbelgottesdienst – wie soll ich mir das vorstellen?
von Annette Beuschel
101
Kindergottesdienst und Kinderarbeit. Ergebnisse der Erhebung
zusammengestellt von Markus Homann
Soziokulturelle Arbeit mit Kindern
103
Kinder-Filmstadt Hollywuzz
von Arnold Köppen und Erich Schriever
106
Kinderkulturarbeit durch eine evangelische öffentliche Bücherei
von Sigrid Deichmann
108
Wenn Töne Treppen steigen und Texte triumphieren – Kinderlieder selber machen! von Luise Pawlowsky
110
Das Gauklermärchen. Ein Theater von Kindern für Kinder
von Andrea Visser
111
Kinderfreizeit. »Bitte anschnallen, gleich fliegen wir los!«
von Ulrike Vogt
Neue Pflänzchen in der Oase. Versuche neuer Wege
113
Eltern-Kind-Gruppen
von Doris Sandbrink
115
Offener Kindertreif. Zwischen verschiedenen Nationen, Hausaufgaben und Ganztagsbetreuung
von Veronika Kohmüller
118
Der Offene Kindertreff »Stoppelhops« für Kinder von 6 bis 10 Jahren
von Urs Zietan
119
Erlebnistage für Schulklassen. Schule ist überall
von Luise Pawlowsky
121
Tagesbetreuung von Kindern und Jugendlichen
Hinweis auf die Arbeitshilfe für Kirchenkreise und Gemeinden
122
Beschlüsse rheinischer Landessynoden zum Themenbereich »Arbeit mit Kindern« seit 1979
zusammengestellt von Wolfgang Engels
124
Eine Gemeinde will »kinderfreundlich« werden …
von Jürgen Koerver
127
Ein Testament? Aus dem Bericht des Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland auf der Landessynode 1993 (Schlußteil)
von Peter Beier
128
Bastele Dir ein schönes Gemeindekind (Bastelbogen)
131
Die lieben Kids
Ein Würfelspiel für Kirchengemeinden, die sich und ihre Kindergruppen immer wieder (neu) im Blick haben
von Ewald Schulz
Bestellmöglichkeit
Gemeinde … Oase für Kinder
Eine Arbeitshilfe, vorgelegt vom Ausschuß »Arbeit mit Kindern« der Evangelischen Kirche im Rheinland
Ppbck., 160 Seiten, € 8,10
Die Arbeitshilfe konnte über den Medienverband der Evangelischen Kirche im Rheinland bestellt werden.